
Ausgabe Nr. 35 Online-Journal zur allgemeinen Weiterbildung älterer Erwachsener
Im Büßerhemd nach Canossa
Und noch ein Buch im Jubiläumsjahr über Canossa
In diesem Jahr gibt es viele Ausstellungen zum Mittelalter.
Dementsprechend viele Ausstellungskataloge natürlich. Auch ein kleines
aber feines Buch über Canossa, den legendären Gang Heinrichs IV. nach
Canossa ist erschienen. Eine moderne Deutung dieses legendären Gangs für
Fachwissenschaftler und breite Leserkreise. Der Autor, Stefan Weinfurter
ist Historiker, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der
Universität Heidelberg.![]()
Jahrestag
Am 7. August diesen Jahres jährte sich nun also zum neunhundertsten
Mal der Todestag Heinrichs IV. Sein Name steht für einen epochalen,
dramatischen Konflikt zwischen dem römisch-deutschen Königtum bzw.
Kaisertum und dem Papsttum, bekannt natürlich auch unter dem Titel
Investiturstreit. Dieser Begriff, so wird am Ende dieses Buches klar
sein, ist eine unzureichende Bezeichnung für eine Auseinandersetzung,
die für eine langwährende und europäische Zäsur sorgen sollte. Eine
Auseinandersetzung, die anfangs noch recht begrenzt für Spannungen
sorgte, sich dann aber doch recht schnell zu einer grundsätzlichen
Frage nach der rechten Zuordnung von weltlicher und geistlicher Gewalt
entwickelte.
![]()
Das Thema
Was war geschehen? Eine Antwort auf diese Frage gibt natürlich das
hier vorgestellte Buch. Entscheidend scheint mir aber, wie der Autor
versucht, weniger die politische Geschichte, als den gesellschaftlichen
Wandel der Zeit des Investiturstreits und die dahinter stehenden Ideen
zu beschreiben und dem Leser nahe zu bringen. Natürlich erfahren wir
auch, was zum Kirchenbann Heinrichs, zur Exkommunikation und zur
abenteuerlichen Reise nach Oberitalien, zur Burg Canossa im Winter 1077
führte. Ebenso erfahren wir, dass und wie der König wieder aufgenommen
wurde in die Gemeinschaft der Gläubigen und wie er auch wieder seine
Stellung im Reich stärken konnte. Es folgen drei Jahrzehnte sich
hinziehende wechselvolle Kämpfe. Jedoch, er wird unterliegen. Die
Einigung zwischen Reich und Kirche fand ohne ihn statt. Er starb, vom
eigenen Sohn aus der Herrschaft gedrängt und, wiederum, unter dem
Kirchenbann.![]()
Inhalt
Das Thema wird eröffnet mit einer weit angelegten Darstellung über
die Ereignisse 1076/77. Sodann folgen 10 systematisch angelegte Kapitel.
Darin beschreibt der Autor die Entwicklung seit Heinrich III., die
zerbrechende Einheit unter Heinrich IV., dazu die Wandlungen in der
Gesellschafts- und Herrschaftsordnung, das Papsttum unter Gregor VII.,
dessen Anspruch auf Gehorsam „im gesamten römischen Erdkreis“, das
Verhältnis zwischen Heinrich IV. und den Bischöfen, den Wertewandel und
das neue Königsideal, den Kampf der Könige und das Ende Gregors VII.,
das Investiturproblem und seine Entwicklung und schließlich den Verrat
Heinrichs V. Es endet in der Schlussbemerkung mit der Aussage, dass
„Canossa“ nicht nur das Ereignis vom Januar 1077 bezeichnet, sondern
auch eine „historische Chiffre“.![]()
Entzauberung der Welt
Wofür also steht Canossa 1077? Für eine Entzauberung der
frühmittelalterlichen Einheitswelt, für einen Prozess der zunehmenden
Differenzierung. War bis dahin Kirche und Staat, geistlich und weltlich
nahezu eine Einheit, so driftete mit Heinrich IV. und den durch ihn
provozierten Konflikt zwischen Königtum und Papsttum das Reich und
Europa in eine Trennung hinein, die im 12. Jahrhundert den dann
auszumachenden Realitätsschub hervorbringt. In dem Maße wie sich das
Papsttum genötigt sah seinen Anspruch auf die Weltherrschaft zu
formulieren, entsakralisiert sich das Königtum. So musste unweigerlich
eine neue gesellschaftliche Ordnung entstehen. Diese durch eine
Rationalisierung von Herrschaft veränderte Welt, lässt sich eben am
besten mit dem Begriff von einer Entzauberung der Welt im Sinne von Max
Weber beschreiben.![]()
Was auch nicht fehlt
Das, so mag nun die geneigte Leserschaft befürchten, hört sich doch
sehr trocken an. Aber mitnichten! Es fehlt nicht an Details um die
Alpenüberquerung im frostklirrenden Januar 1077 vor die Burg Canossa, in
die sich der Papst vor dem König geflüchtet hat. Auch die Rituale des
reuigen Büßers zur Lösung vom päpstlichen Bann bekommen wir Leser auf
fesselnde Weise dargestellt, so dass allen am Ende klar wird – dies ist
eine erzwungene Vergebung, eine Erpressung, die beide Seiten erkennen
und akzeptieren. Ganz nebenbei erkennen die Leserinnen und Leser das
politische System der salischen Königsherrschaft und den überzeitlichen
Konflikt zwischen geistlicher Macht und weltlicher Herrschaft. Dies war
letztlich das Ansinnen des Autors.![]()
Titelnachweis
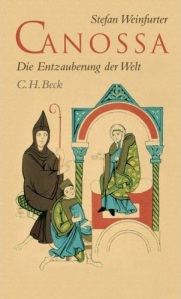
Stefan Weinfurter
Canossa. Die Entzauberung der Welt
C.H. Beck Verlag, München 2006, 19,90 €![]()