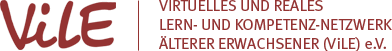Lichtenberg.
Lichtenberg.
Lichtenberg ist der elfte Verwaltungsbezirk von Berlin und hat rund 260.000 Einwohner. Er entstand 2001 durch die Fusion der bis dahin eigenständigen Bezirke Lichtenberg und Hohenschönhausen.
Alle Ortsteile des heutigen Bezirks gehören seit der Gründung von Groß-Berlin im Jahr 1920 zum Berliner Stadtgebiet, darunter der namensgebende Ortsteil Lichtenberg.
Das Dorf Lichtenberg selbst entstand im Zuge der deutschen Kolonisation des Barnim um 1230. Es wurde allerdings erst am 24. Mai 1288 urkundlich in einem Grenzvertrag erwähnt. Der erste historische Nachweis für das Dorf Rosenfelde (1699 in Friedrichsfelde umbenannt) stammt aus dem Jahr 1265.
Bei der Gründung von Groß-Berlin im Jahr 1920 wurde die Stadt Lichtenberg zusammen mit der Landgemeinde sowie dem Gutsbezirk Biesdorf, den Landgemeinden Friedrichsfelde, Kaulsdorf, Mahlsdorf, Marzahn und Hellersdorf einschließlich des Gutsbezirks Wuhlgarten zum neu gegründeten 17. Berliner Verwaltungsbezirk, der den Namen Lichtenberg erhielt.
Im Jahr wies 1965 Lichtenberg 168.897 Einwohner auf, die sich 1979 verringerten, weil die Ortsteile Marzahn, Mahlsdorf, Kaulsdorf, Biesdorf und Hellersdorf ausgegliedert wurden. Der Magistrat schuf daraus den eigenständigen Stadtbezirk Marzahn, der 1986 noch einmal geteilt wurde. In der Normannenstraße befand sich seit den späten 1960er Jahren die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit. Am 23. September 2008 erhielt der Bezirk den von der Bundesregierung verliehenen Titel Ort der Vielfalt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Lichtenberg
Friedrichsfelde.
Das Dorf wurde von niederdeutschen Siedlern um 1230 gegründet. Die urkundliche Erwähnung des Pfarrers Ludwig zu Rosenfelde ist 1265 der erste Nachweis des Dorfes Rosenfelde. 1375 wies das Landbuch für Rosenfelde 104 Hufen aus, davon sechs Pfarrhufen. Diese ganz ungewöhnliche Größe umfasst etwa die doppelte Zahl von Hufen, wie sie auf dem Barnim für planmäßig angelegte deutsche Dörfer durchschnittlich üblich sind. Rosenfelde wurde 1699 nach dem Kurfürsten Friedrich III. in Friedrichsfelde umbenannt.
Heute ist der Ortsteil geprägt von vielgeschossigen Neubauten. Die überwiegende Anzahl der Wohngebäude bilden die sechs- bis etwa zwanziggeschossigen Plattenbauten, für die zwischen den 1960er und den 1990er Jahren neue Flächen erschlossen und gänzlich neue Straßennetze angelegt wurden. Unmittelbar nördlich des Tierparks befindet sich das Gelände des Bildungs- und Verwaltungszentrums, ein großer Verwaltungskomplex, auf dem neben dem Statistischen Landesamt weitere Ämter wie das Finanzamt und die Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin untergebracht sind. Es entstand aus einem in der DDR-Zeit errichteten und abgeschotteten Stasi-Gelände.
Die evangelische Dorfkirche Friedrichsfelde (bzw. ihr Vorgängerbau) ist einer der ältesten Kirchenbauten des Bezirks Lichtenberg. Dorf und Kirche wurden am 2. April 1265 erstmals urkundlich erwähnt. Diese mittelalterliche Kirche wurde zwischen 1718 und 1728 wesentlich erweitert und im Barockstil umgestaltet. Weil die Kirche für die zunehmende Anzahl an Gemeindemitgliedern bald zu klein wurde, beschloss der Kirchenrat einen Neubau, der unmittelbar neben der alten Kirche von 1887 bis 1890 errichtet wurde. Erst nach Einweihung der neuen (zweiten) Kirche wurde 1891 das erste Gebäude abgetragen. Im Dezember 1943 wurde die Kirche durch eine Luftmine stark beschädigt. Im April 1945 beschossen deutsche Tiefflieger das Gebäude, das nun ausbrannte und nicht mehr betretbar war. Das alte Gotteshaus stand noch bis 1950 als Ruine. Als schließlich etwas Geld aufgetrieben werden konnte, erhielt der Berliner Architekt Herbert Erbs den Auftrag, einen vereinfachten Wiederaufbau durchzuführen. Errichtet wurde ein rechteckiger Saalbau mit Sakristeianbau und quadratischem Dachturm. Der Bau wirkt sehr schlicht.
Das Schloss Friedrichsfelde ist ein im frühklassizistischen Baustil gestaltetes Schloss im Tierpark Friedrichsfelde. Es wurde 1695 als Schloss Rosenfelde vom kurbrandenburgischen Generalmarinedirektor Benjamin Raule erbaut. Dieser erste fünfachsige Bau wurde vermutlich nach Plänen von Johann Arnold Nering im holländischen Landhausstil errichtet. Im Jahr 1698 fiel Benjamin Raule in Ungnade, er wurde inhaftiert und enteignet. Das Schloss fiel an den preußischen König und wurde in Friedrichsfelde umbenannt. Im späteren Verlauf wurde das Schloss mehrmals verkauft. Die heutige Form erhielt das Schloss im Jahr 1800. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Schloss relativ unbeschädigt. Nach der Enteignung im Zuge der Bodenreform verfielen sowohl das Bauwerk als auch der umgebende Schlosspark. Als 1954 der Beschluss zur Anlage eines eigenen Tierparks für Ost-Berlin gefasst wurde, diente das Schloss für einige Jahre als Sitz der Organisatoren für den Umbau des Gartens, Teile des Gebäudes wurden als Stallungen des Tierparks verwendet. Erst im Zeitraum zwischen 1970 und 1981 wurde das Schloss auf Initiative des Tierparks Berlin renoviert.
Der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde ist einer der beiden Zoologischen Gärten in Berlin und ist mit 160 Hektar Fläche der größte Landschaftstiergarten in Europa. Durchschnittlich 7500 Tiere in rund 900 Arten werden in den Gehegen präsentiert.
Der Tierpark Berlin entstand aufgrund der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zoologische Garten Berlin lag im britischen Sektor Berlins, daher fehlte der Hauptstadt der DDR eine eigene tiergärtnerische Einrichtung. Bei der Eröffnung des Tierparks am 2. Juli 1955 konnten etwa 400 Tiere in 120 Arten besichtigt werden. Nach der Wiedervereinigung wurde diskutiert, ob Berlin zwei Zoologische Gärten brauche oder ob man den Tierpark schließen solle. Diese Diskussion kam aber schnell zum Erliegen. Die Rechtsform des Tierparks erfuhr eine Umwandlung von einer Körperschaft zur Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH. Die Kooperation mit dem seit 1844 bestehenden Zoologischen Garten Berlin wurde zunehmend intensiviert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Friedrichsfelde
Karlshorst.
Als eigentliches Gründungsdatum gilt der 25. Mai 1895, als mit der Kolonie Carlshorst die ersten Wohnhäuser, unter anderem in der heutigen Lehndorffstraße, errichtet wurden. Die Schreibweise Karlshorst wurde am 24. Juni 1901 offiziell festgelegt.
Nach der Fertigstellung des Bahnhof Berlin-Karlshorst 1902 konnte man sowohl Berlin als auch das Naherholungsgebiet um den Müggelsee in Cöpenick problemlos und schnell erreichen. So avancierte die Villenkolonie schnell zu einem der beliebtesten Vororte der Hauptstadt und wurde oft als „Dahlem des Ostens“ bezeichnet.
Karlshorst war bis 1920 Bestandteil der Gemeinde Friedrichsfelde. Mit dem Inkrafttreten des Groß-Berlin-Gesetzes wurde Karlshorst am 1. Oktober 1920 ein Ortsteil des Bezirk Lichtenberg.
In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 wurde in Karlshorst im Offizierskasino der Pionierschule 1, wo sich während der Schlacht um Berlin das Hauptquartier der 5. Armee der Roten Armee befand, die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht unterzeichnet. Die Gebäude dienten dann bis 1949 als Hauptquartier der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD). Während dieser Zeit wurde in der Presse der Name „Karlshorst“ oft als Synonym für die SMAD verwendet.
Zwischen 1945 und 1962 war der nördliche Bereich von Karlshorst zu großen Teilen sowjetisches Sperrgebiet, das ab 1949 aber von deutschen Bewohnern betreten werden konnte. Ein sogenanntes Russenmagazin avancierte in dieser Zeit zu einer Einkaufsmöglichkeit mit moderaten Preisen und ohne Lebensmittelmarken. Die im Sperrgebiet stehenden kirchlichen Anlagen wie die katholische Pfarrkirche St. Marien oder die evangelische Pfarrkirche „Zur frohen Botschaft“ wurden von den Militärs entwidmet und meist zu Lagerzwecken benutzt.
Zunächst wurde das besetzte Gebiet auf die östlich der Treskowallee gelegenen Straßen und Plätze verkleinert, die Sperrmauer von der Magistrale zurückgezogen. Die Gebäude der früheren Wehrmachtsschule dienten dem Oberkommando der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland und der Verwaltung des KGB in der DDR bis zum späteren vollständigen Truppenabzug als Hauptstandort. Im Gebäude der Kapitulation wurde mit Unterstützung der DDR das Museum der bedingungslosen Kapitulation des faschistischen Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941–1945 eingerichtet. Daraus entstand ab 1991 das Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst, das der Kapitulation und der Entwicklung der deutsch-sowjetischen bzw. deutsch-russischen Beziehungen, seit 1945 gewidmet ist.
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Wohnhäusern und der Ausbau der Infrastruktur führten ab 1994 dazu, dass sich Karlshorst wieder zu einem gefragten Wohngebiet entwickelte. Der Erhalt der Trabrennbahn, der Neubau vieler Ein- und Zweifamilienhäuser und zahlreiche neue Siedlungsprojekte sind dabei besonders erwähnenswert. Bis 2016 will die WPK Grundstücksentwicklungsgesellschaft auf dem ehemaligen Militärgelände ein neues Stadtviertel mit 1200 Wohnungen in 350 Häusern errichten.
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) ist mit rund 12.000 Studierenden und über 500 Mitarbeitern die größte staatliche Fachhochschule Berlins.
Die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) ist eine kirchliche, staatlich anerkannte Fachhochschule in Berlin. Sie befindet sich in der Trägerschaft des Erzbistums Berlin und hat ihren Sitz in der Köpenicker Allee 39-57 im Ortsteil Karlshorst des Berliner Bezirks Lichtenberg.
Im Wintersemester 2011/2012 waren an der KHSB ca. 1300 Studenten immatrikuliert, der Lehrkörper bestand aus 43 Professoren und 105 Lehrbeauftragten.
Die Trabrennbahn Karlshorst ist eine historische 37 Hektar große Anlage für Pferderennen in Karlshorst. Die Rennbahn Karlshorst ist nach dem Vorwerk Karlshorst die älteste Ansiedlung in der Umgebung des heutigen Karlshorst. Ab dem 21. Jahrhundert ist ihre Zukunft ungewiss, das Gelände stand zum Verkauf, wurde zwischenzeitlich auch kulturell genutzt und soll nach den Planungen des Bezirksamts zu einem Pferdesportpark ausgebaut werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Karlshorst
Lichtenberg.
Lichtenberg ist ein Ortsteil im gleichnamigen Bezirk Lichtenberg. Zur Abgrenzung spricht man auch von Alt-Lichtenberg.
Der heutige Ortsteil geht zurück auf das im 13. Jahrhundert im Barnim gegründete Dorf Lichtenberg. Dieses Dorf blieb über viele Jahrhunderte eine kleine, landwirtschaftlich geprägte Siedlung mit wenigen hundert Einwohnern im Osten der Stadt Berlin. Erst Ende des 19. Jahrhunderts stieg durch die Industrialisierung die Einwohnerzahl Lichtenbergs um ein Vielfaches, sodass der Ortschaft 1907 das Stadtrecht verliehen wurde. Durch die Gründung von Groß-Berlin im Jahr 1920 wurde die Stadt Lichtenberg jedoch nach Berlin eingemeindet und bildet seitdem den namensgebenden Ortsteil für den Berliner Bezirk Lichtenberg.
Das Gebiet zwischen der Landsberger Chaussee (heute Landsberger Allee) und der Rittergutstraße (heute Josef-Orlopp-Straße) – auch als „Industriegebiet Herzbergstraße“ bekannt geworden – entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort im aufstrebenden Lichtenberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Großbetriebe enteignet. Viele konnten anfangs wegen demontierter Maschinen oder fehlender Rohstoffe nicht produzieren. Erst ab 1952 begann wieder eine nennenswerte Erzeugung von Industriegütern. Die Fabriken wurden zu volkseigenen Betrieben (VEB) umgewandelt. Durch den politischen und wirtschaftlichen Wandel im Jahr 1990 sowie wegen häufig qualitativ und preislich nicht weltmarktfähiger Produkte wurden die meisten Betriebe nun schrittweise abgewickelt. Übrig blieben kleine oder mittelständische Handwerksbetriebe; neu hinzugekommen sind zahlreiche Einkaufszentren und Autohäuser. Zur Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Einrichtungen der tourismusnahen Wirtschaft im Bezirk besteht seit 2007 das Projekt Tourismusmarketing Lichtenberg.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Lichtenberg
Falkenberg.
Falkenberg im Bezirk Lichtenberg ist nicht zu verwechseln mit der Gartenstadt Falkenberg und dem Falkenberg, beides im Bezirk Treptow-Köpenick gelegen.
Falkenberg wurde im 13. Jahrhundert durch bäuerliche Siedler auf dem Barnim als Straßendorf angelegt. Die erste schriftliche Erwähnung folgte am 26. Juni 1370 in einer Urkunde Markgraf Ottos des Faulen. Im Jahr 1791 wurde Falkenberg von Marie-Elisabeth von Humboldt – der Mutter von Wilhelm und Alexander von Humboldt – erworben. 1875 erwarb die Stadt Berlin das ehemalige Rittergut zur Anlage von Rieselfeldern. Die Eingemeindung folgte 1920 durch das Groß-Berlin-Gesetz.
In den 1930er und 1940er Jahren gab es nur geringfügige Erweiterungen im Gebiet des alten Dorfes, so wurden lediglich einige Siedlungen in Richtung Ahrensfelde sowie die katholische Kirche St. Konrad von Parzham neu gebaut. Am 21. April 1945, wenige Tage vor dem Einmarsch der Roten Armee sprengten Wehrmachtsangehörige die über 700 Jahre alte Dorfkirche.
Als der Bau von Großwohnsiedlungen in Ost-Berlin begann, wurde Falkenberg kaum davon betroffen. Der Ortsteil lag außerhalb des Interesses der städtischen Entwicklung. Im Zuge der großstädtischen Entwicklung wurden die Rieselfelder hier und in der Umgebung 1968 durch ein modernes Klärwerk ersetzt. Am 1. Januar 2001 kam Falkenberg durch die Bezirksreform wie die anderen Ortsteile Hohenschönhausens zum Bezirk Lichtenberg. Im gleichen Jahr eröffnete das Tierheim Berlin hier einen kompletten Neubau. Durch seinen architektonisch reizvollen Bau ist die Anlage immer wieder auch für Filmregisseure von Interesse. Der bis dahin südliche Teil von Falkenberg, der sich spitzwinklig bis an den S-Bahnhof Gehrenseestraße erstreckte, kam 2002 zu Neu-Hohenschönhausen.
Das Tierheim Berlin zählt mit einer Fläche von 16 Hektar zu den größten Tierheimen Europas. Der Grundstein für den Neubau wurde am 18. August 1999 gelegt, die offizielle Eröffnung erfolgte am 9. Juni 2002. In Betrieb ging das Tierheim bereits einige Monate zuvor im September 2001. Im Tierheim Berlin werden jedes Jahr 12.000 in Not geratene Tiere aufgenommen, versorgt und an neue Besitzer vermittelt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Falkenberg
Malchow.
Während des 13. Jahrhunderts gründeten deutsche Bauern das Dorf Malchow, vermutlich um 1230, wie die meisten Dörfer im Berliner Raum auf dem Barnim. Bereits vor 1375 war das Dorf im Besitz des Malchower Nebenzweigs des Adelsgeschlechts von Barfus. Sie verkauften es 1684 an Paul von Fuchs. Ab 1734 wurde Malchow von Niederschönhausen verwaltet, bis es – nachdem es im 19. Jahrhundert noch einmal unter privater Führung stand – 1882 von der Stadt Berlin erworben wurde, die große Flächen als Rieselfelder nutzte. In den 1930er Jahren expandierte Malchow durch die Entstehung der Siedlung Margaretenhöhe und der von den NILES-Werken errichteten Niles-Siedlung südöstlich des Malchower Sees. Seit der Bezirksreform im Jahr 2001 und der daraus resultierenden Auflösung des Bezirks Hohenschönhausen gehört Malchow zum Bezirk Lichtenberg. Die Grenzen des Ortsteils wurden ebenfalls neu geschnitten; die Siedlung Margaretenhöhe wurde dem Ortsteil Wartenberg und die Niles-Siedlung dem Ortsteil Neu-Hohenschönhausen zugeschlagen. Nach der Einwohnerzahl ist Malchow mit 488 Einwohnern (Stand: 31. Dezember 2010) der kleinste Ortsteil von Berlin.
Der Malchower See hat eine Größe von 74.318 m², der gesamte Wasserkörper besitzt ein Volumen von 226,555 m³ und die durchschnittliche Tiefe beträgt 3,05 m, wobei die größte Tiefe des Sees 6,46 m beträgt. Das Gebiet um den Malchower See weist eine landschaftlich starke Strukturierung auf, was häufig auf den Einfluss des Menschen zurückzuführen ist. So befindet sich im Südosten ein angelegter Park mit Rasenflächen, der als Naherholungsgebiet von der Bevölkerung genutzt wird. Im südlichen Bereich befindet sich ein kleineres Waldstück mit Bewuchs durch Eschen, Ahorn und Pappeln. Der See ist ein viel genutztes Angelrevier.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Malchow
Wartenberg.
Wartenberg ist ein Ortsteil im Bezirk Lichtenberg. Im Sprachgebrauch ist meist nicht der alte Dorfkern gemeint, sondern das Neubaugebiet Wartenberg, das zum benachbarten Ortsteil Neu-Hohenschönhausen gehört und sich auf der früheren Feldmark von Wartenberg befindet.
Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes fand 1270 statt. Bis 1448 war das Dorf im Besitz mehrerer Berliner und Cöllner Bürger. Die Stadt Berlin kaufte 1882 das Gut Wartenberg und begann mit der Anlage von Rieselfeldern. Das Gut selbst wurde zum Vorwerk des Stadtgutes Malchow. 1920 folgte mit dem Groß-Berlin-Gesetz die Eingemeindung. Am 21. April 1945 wurde die Dorfkirche von Wehrmachtsangehörigen gesprengt, da sie andernfalls als Orientierung für die anrückende Rote Armee hätte dienen können.
Baulich ist Wartenberg sehr unterschiedlich gestaltet. So finden sich direkt am S-Bahnhof Wartenberg Hochhäuser in Plattenbauweise, die in den 1980er Jahren errichtet wurden. Rund um die Gaststätte „Wartenberger Hof“ finden sich zahlreiche neu errichtete Einfamilienhäuser und im Dorfkern gibt es noch alte Bauernhöfe. Nördlich der Besiedlung wird seit 2000 der Landschaftspark Wartenberger Feldmark als Naherholungsgebiet auf den ehemaligen Rieselfeldern entwickelt.
Landschaftspark Wartenberg. Im Jahr 2000 führte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt einen Ideen- und Realisierungswettbewerb Wartenberger Feldmark durch. Unter dem Motto „Landschaft mit Aussicht“ sollte ein „Erholungsraum am Stadtrand unter Berücksichtigung einer tragfähigen landwirtschaftlichen Nutzung sowie für den Naturschutz wertvollen Bereichen“ entstehen. Schließlich entstand ein 210 Hektar großer Landschaftspark als Bestandteil des Berliner Barnim.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Wartenberg
Neu-Hohenschönhausen.
Neu-Hohenschönhausen befindet sich im Nordosten Berlins. Der Ortsteil ist weitestgehend identisch mit dem Neubaugebiet Hohenschönhausen-Nord. In den 1970er Jahren entstanden rund um den alten Dorfkern von Hohenschönhausen sowie nördlich der Leninallee (seit 1992: Landsberger Allee) Neubaugebiete Hohenschönhausen I und Hohenschönhausen II für insgesamt 25.000 Einwohner. Weil die Bevölkerungszahlen aber rasch anstiegen, begann 1981 die Erschließung des künftigen Neubaugebietes Hohenschönhausen-Nord. Der neue Stadtbezirk umfasste am ersten Tag rund 67.000 Bewohner, bis 1989 stieg die Einwohnerzahl bis auf 118.000, das entsprach rund 9,2 Prozent der Gesamtbevölkerung Ost-Berlins. Vor allem junge Familien erhielten die begehrten Neubauwohnungen. Die Wende führte zu einem schrittweisen Rückgang der Einwohnerzahlen: Mitte der 1990er Jahre waren es noch knapp 115.000, um die Jahrtausendwende um 110.000.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Neu-Hohensch%C3%B6nhausen
Alt-Hohenschönhausen.
Alt-Hohenschönhausen ist ein Ortsteil im Bezirk Lichtenberg. Bis zur Bezirksreform 2001 war er unter der Bezeichnung Hohenschönhausen der namensgebende Ortsteil des Bezirks Hohenschönhausen. Bei der Neubildung des Ortsteils Neu-Hohenschönhausen im Jahr 2002 wurde der Namen in Alt-Hohenschönhausen geändert.
Hohenschönhausen wurde als ein typisches Straßendorf angelegt. Die Besiedlung des Ortes begann in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Zuge der deutschen Ostexpansion. Im Jahr 1230 begann der Bau der spätromanischen Dorfkirche, die heute das älteste noch existierende Gebäude des Ortsteils ist. Bis in das 19. Jahrhundert hinein wechselten der Ort und das Rittergut häufig den adeligen Besitzer. Ab 1802 befand sich das Gut Hohenschönhausen im Besitz der Familie von Eisenhard. Wegen zu hoher Verschuldung wurde es ab 1812 von Municipalrat Cosmar und Staatsrat Christian Friedrich Scharnweber verwaltet. 1817 erwarb Scharnweber das Gut und vollzog die Trennung von Guts- und Bauernland im Zuge der preußischen Reformen. Die spannfähigen Bauern wurden so Eigentümer des Bodens, hatten dafür aber das Wartenberger Feld, das ein Drittel ihres Landes ausmachte, an den Gutsbesitzer abzutreten.
Die Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde maßgeblich von der Berlins beeinflusst. Durch das anhaltende Stadtwachstum verlagerte die Stadt diverse Institutionen in die Vororte, während gleichzeitig die Bebauung auf diese übergriff. Der Dorfkern ist der älteste Teil von Hohenschönhausen und komplett denkmalgeschützt. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die Gemeinde kaum über diese Grenzen hinaus, folglich befand sich hier annähernd alles, was die Menschen für den täglichen Bedarf brauchten.
Mit dem Groß-Berlin-Gesetz vom 1. Oktober 1920 wurde Hohenschönhausen als Bestandteil Berlins dem Bezirk Weißensee zugeordnet. Die 1920er Jahre bedeuteten für Hohenschönhausen vor allem einen Aufschwung im Fürsorge- und Erholungsbereich. So entstanden infolge der wirtschaftlichen Krisen mehrere Schulspeisungsstellen, eine Warmwasserbadeanstalt, ein Kinderhort sowie eine vergleichsweise große Volksbücherei. Auf der anderen Seite wurden am Orankesee ein Freibad und mehrere Sportanlagen, vor allem für Fußball, angelegt. Dennoch waren diese Jahre auch geprägt von Armut und vor allem von Wohnungsnot. Eine erste Abhilfe wurde durch den Bau von mehreren Siedlungshäusern an der Paul-Koenig-Straße geschaffen, Mitte der 1920er Jahre wurden nach Plänen von Bruno Taut mehrere Häuser an der Wartenberger Straße, am Malchower Weg sowie an der Suermondtstraße errichtet. 1934 entstand die Wohnsiedlung Weiße Taube beiderseits der Landsberger Allee und um 1937 die Kriegsopfersiedlung am Malchower Weg, die für invalide Teilnehmer des Ersten Weltkriegs vorgesehen war. Etwa zur gleichen Zeit entstand am Malchower See die Niles-Siedlung.
Nach der bedingungslosen Kapitulation vom 8. Mai bot sich in den Vororten zunächst auch in etwa das gleiche Bild wie in der Innenstadt Berlins. Neben dem Fehlen von Strom und Gas grassierten Krankheiten wie Typhus und Ruhr; Flüchtlinge als auch Waisenkinder irrten auf den Straßen umher. Das größte Problem bestand allerdings darin, die Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen. Hierfür wurde bereits am 28. April 1945 das Ernährungsamt Weißensee eingerichtet, es sollte vor allem die Versorgung der zivilen Bevölkerung mit Fleisch und Brot sicherstellen.
Noch in den 1950er Jahren war Hohenschönhausen alles andere als großstädtisch. Die SED beschloss 1971 auf dem VIII. Parteitag das sozialistische Wohnungsbauprogramm. Auf dem IX. Parteitag 1976 konkretisierte sie die Planungen und stellte die Aufgabe, dass die in Ost-Berlin herrschende Wohnungsnot bis 1990 zu beheben sei. Die ersten – als Plattenbauten errichteten – Gebäude entstanden in den Jahren 1972 bis 1975 zwischen der Wartenberger und Falkenberger Straße (heute Gehrenseestraße). Obwohl Wert darauf gelegt wurde, dass sich Dorfkern und Neubausiedlung architektonisch miteinander vertrugen, fiel die Umsetzung jedoch weniger harmonisch aus.
Bereits im Sommer 1951 übernahm das DDR Ministerium für Staatssicherheit (MfS) die zentrale Untersuchungshaftanstalt der sowjetischen Geheimpolizei (Kellergefängnis) und das dazugehörige Gelände des ehemaligen Speziallagers Nr. 3 und nutzte es bis zur Wende ebenfalls als zentrale Untersuchungshaftanstalt. Die ersten Jahre nach der Wende waren von zahlreichen Wegzügen gekennzeichnet. Allein in den Jahren bis 2002 verringerte sich die Bevölkerung um 18 Prozent.
Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen besteht aus den Räumlichkeiten der ehemaligen zentralen Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit der DDR, die von 1951 bis 1989 in Weißensee bzw. Hohenschönhausen in Betrieb war. Dort wurden vor allem politische Gefangene inhaftiert und physisch und psychisch gefoltert. Heute existiert an gleicher Stelle eine Gedenkstätte als Erinnerungsort für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland. Die Gebäude der ehemaligen Haftanstalt wurden 1992 unter Denkmalschutz gestellt. Die Gedenkstätte ist Mitglied der Platform of European Memory and Conscience.
Die Dorfkirche Hohenschönhausen (seit 1905 Taborkirche) ist das älteste Gebäude in Alt-Hohenschönhausen. Der an der Hauptstraße gelegene Bau zählt zu den kleinsten Dorfkirchen in Berlin.
Das Schloss Hohenschönhausen (auch: Bürgerschloss Hohenschönhausen) ist ein Gutshaus, das sich im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen befindet. Es ist derzeit im Besitz des Fördervereins Schloss Hohenschönhausen und steht auf der Berliner Denkmalliste. Der Förderverein führt regelmäßig Veranstaltungen verschiedener Art wie Ausstellungen, Lesungen, Vorträge und Konzerte in den Räumlichkeiten des Schlosses durch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Alt-Hohensch%C3%B6nhausen
Fennpfuhl.
Fennpfuhl ist ein Ortsteil im Bezirk Lichtenberg. Der Name leitet sich vom Wohngebiet am Fennpfuhl beziehungsweise dem dortigen Fennpfuhl ab. Erst nach der Verwaltungsreform 2001 wurde das Wohngebiet zu einem eigenen Ortsteil, zuvor gehörte es zu Lichtenberg mit dem Zusatz (Nord). Fennpfuhl ist nach Friedenau der am zweitdichtesten besiedelte Ortsteil Berlins.
Am 2. Dezember 1972 erfolgte mit der Grundsteinlegung für das Doppel-Hochhaus am Roederplatz der offizielle Baubeginn für das Gebiet am Fennpfuhl, das die erste zusammenhängende Plattenbau-Großwohnsiedlung der DDR wurde. In den nächsten Jahren entstanden im damaligen Bereich Lichtenberg (Nord) Wohnhäuser für 50.000 Einwohner. Von der sehr dünnen alten Bebauung blieb nur wenig erhalten. Die Bebauung um den als gesellschaftliches Zentrum geplanten Anton-Saefkow-Platz mit Wohnhochhäusern mit Geschäften, einer Schwimmhalle, einer Sporthalle und einem Kaufhaus (Konsument) sowie die Anlage des Fennpfuhlparks dauerte hingegen aufgrund von Bauproblemen wegen des morastigen Untergrunds noch bis in die 1980er Jahre.
Die Handels- und Dienstleistungsqualität des Ortsteils wurde, nach 1990, durch Um- oder Neubauten erheblich verbessert. So zog ein Warenhaus in das alte Konsument-Gebäude, die drei Gebäude des ehemaligen Bauarbeiter-Hotels nordöstlich des Wohngebietes wurden mit einem Neubau zusammengefasst. Bis 2001 wurden fast alle Wohnhäuser saniert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Fennpfuhl
Rummelsburg.
Im Jahr 1861 wurde Rummelsburg, bis dahin Exklave Berlins im Kreis Niederbarnim, dem Gutsbezirk Boxhagen eingegliedert. Am 30. Januar 1889 wurde der Gutsbezirk aufgelöst und die eigenständige Gemeinde Boxhagen-Rummelsburg gebildet. Die Einwohnerzahlen im 19. Jahrhundert steigerten sich mit der raschen industriellen Entwicklung von 1875 mit 2.135 auf rund 20.000 im Jahre 1895 und mehr als 50.000 im Jahre 1910. Bei einer Neugliederung des Bezirks im Jahr 2002 (ein Jahr nach der Berliner Bezirksreform) wurde Rummelsburg zu einem eigenständigen Ortsteil.
Das städtische Arbeitshaus Rummelsburg, später Gefängnis Rummelsburg genannt, war das Arbeitslager des benachbarten Waisenhauses und entstand am Ende des 19. Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere der politischen Teilung Berlins wurde die Einrichtung als Haftanstalt der Volkspolizei genutzt.
Im Auftrag der Stadt Berlin wurden zwischen 1877 und 1879 sechs Arrestgebäude sowie entsprechende Wirtschaftseinheiten und eine gesonderte Krankenstation errichtet. Zur Nazizeit wurde die Anlage zum Städtischen Arbeits- und Bewahrungshaus Berlin-Lichtenberg umgebaut. Auch Sonderabteilungen für Homosexuelle und, psychisch Abwegige' wurden in dieser Zeit dort eingerichtet. Unter Beteiligung der Kriminalpolizei wurden am 13. Juni 1938 über 10.000 Personen als Asoziale in Konzentrationslager verschleppt. Zu DDR-Zeiten waren in den 1970er und 1980er Jahren mehrere tausend Häftlinge in den Gebäuden untergebracht. Auch einige hundert (west-)deutsche Gefangene gab es, die unter anderem als Fluchthelfer zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden, bis sie von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland freigekauft werden konnten. Die Haftanstalt wurde im Oktober 1990 geschlossen.Im Januar 2007 verkaufte die landeseigene Wasserstadt GmbH einen Großteil der leer stehenden Gebäude an die Berliner Maruhn-Immobiliengruppe, die für 40 Millionen Euro die Gebäude zu Eigentums- und Mietwohnungen umbaut. Baubeginn war im April 2007, am 15. September 2007 konnte für die ersten sechs Gebäude Richtfest gefeiert werden. Im Januar 2008 zogen die ersten neuen Mieter ein, insgesamt sind 150 hochwertige Wohnungen und Lofts vorgesehen.
Der Rummelsburger See (auch Rummelsburger Bucht genannt) ist eine Spreebucht. Der See und seine Uferregionen werden besonders an den Wochenenden von vielen Berlinern als Naherholungsgebiet genutzt.
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) ist mit rund 12.000 Studierenden und über 500 Mitarbeitern die größte staatliche Fachhochschule Berlins. Es existieren etwa 70 Studienangebote in den Bereichen Technik, Informatik, Wirtschaft, Kultur und Gestaltung.
Der Bahnhof Berlin-Rummelsburg ist ein ehemaliger Güterbahnhof und jetziger Betriebsbahnhof. Er dient vor allem dem Fernverkehr zum Abstellen und zur Wartung von Reisezuggarnituren.
Für die Wartung der in Berlin beginnenden und endenden ICE-Züge wurde zeitgleich mit der Sanierung der Stadtbahn 1998 das ICE-Werk Rummelsburg eröffnet. Zusammen mit den Werksanlagen für Schnellzugwagen erstreckt sich das Gelände auf knapp zwei Kilometer Länge und rund 400 Meter Breite. 2002 wurde die Anlage um weitere fünf Werkstattgleise erweitert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Rummelsburg
hf – 04/2014