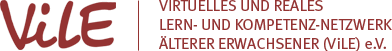Marzahn-Hellersdorf
Marzahn-Hellersdorf
Alle fünf Ortsteile des Bezirks Marzahn-Hellersdorf, stammen ursprünglich aus dem Landkreis Niederbarnim und wurden 1920 durch das Groß-Berlin-Gesetz nach Berlin eingemeindet. Durch den Aufbau des Neubaugebietes Marzahn wuchs Ende der 1970er Jahre vor allem der Ortsteil Marzahn, sodass 1979 aus den fünf heute den Bezirk bildenden Ortsteilen der Bezirk Marzahn gebildet wurde.
Nachdem die Einwohnerzahl – bedingt durch die Entstehung der Neubaugebiete in Hellersdorf und Kaulsdorf – weiter gestiegen war, wurde am 1. Juni 1986 aus den Ortsteilen Hellersdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf der Bezirk Hellersdorf gegründet, der bis zur Bezirksreform 2001 eigenständig blieb.
In den 2000er Jahren kam es zu einem starken Zuzug in die Einfamilienhausgebiete Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf, während im nördlichen Teil des Bezirks die Abwanderung geringer wurde.
Am 25. Mai 2009 erhielt der Bezirk den von der Bundesregierung verliehenen Titel Ort der Vielfalt.
Marzahn.
Das Dorf Marzahn wurde, wie alle Dörfer im Berliner Umfeld des Barnim, um 1230 gegründet. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erhielt Marzahn eine steinerne Dorfkirche. 1300 wurde es unter der Bezeichnung Morczane (oder Murtzan) durch den Markgrafen Albrecht III. erstmals urkundlich erwähnt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war Marzahn 1652 in einem schlechten Zustand: Es gab keine Bauern mehr und nur die fünf Kossäten überstanden den Krieg. Nachdem 1764 das Marzahner Amtsvorwerk unter 19 Siedlerfamilien aus der Kurpfalz aufgeteilt wurde, bildeten die Pfälzer für mehrere Jahrzehnte eine eigene Dorf-, Kirchen- und Schulgemeinde. Sie besiedelten nach und nach vor allem drei größere Flächen um den alten Dorfanger bzw. entlang der Handelsstraßen. Erstmals fand 1874 in Marzahn, das zum neu gebildeten Amtsbezirk Hohenschönhausen gehörte, eine Gemeindevertreterwahl statt. Von 1872 bis 1920 gehörte der Ort zum Landkreis Niederbarnim. 1875 begann in Marzahn das Anlegen von Rieselfeldern, erst 1898/1899 erhielt der Ort einen einfachen Bahnhof. Marzahn wurde am 1. Oktober 1920 mit zu Groß-Berlin eingemeindet und dem Bezirk Lichtenberg zugeordnet. Im Jahr 1936 wurde ein Arbeitslager für Zigeuner errichtet, Hitlers erstes Lager für „Fremdrassige“.Diese Aktion stand im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Olympischen Spiele. Am 16. Juli 1936 wurden hier nach einer landesweiten Verhaftungsaktion 600 Personen interniert. In der Folgezeit entwickelte es sich zum größten Zigeunerlager Deutschlands.
Bei der Einnahme Berlins kamen die sowjetischen Truppen am 21. April 1945 in Marzahn auf Berliner Territorium. Seit 1945 gehörte Marzahn zum Sowjetischen Sektor des in vier Sektoren aufgeteilten Berlins und somit nach der Verfestigung des Ost-West-Konflikts bis 1990 zu Ost-Berlin. Im Jahr 1953 wurde in Marzahn die erste LPG Berlins mit dem Namen Neue Ordnung gegründet, die sich 1958 mit der Biesdorfer LPG zusammenschloss und 1965 mit der LPG Eiche/ Ahrensfelde zur LPG Edwin Hoernle fusionierte. Auf dem VIII. Parteitag der SED wurde 1971 beschlossen, die „Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990“ zu lösen. In diesem Zusammenhang legten die Planer das Neubaugebiet Berlin-Marzahn fest und die Verlegung der Fernverkehrsstraße, die den alten Dorfanger nördlich umgeht. Die Baumaßnahmen dauerten bis Ende der 1980er Jahre. Dominant wurden dabei elfgeschossige Plattenbauten, die jeweils innerhalb von etwa 110 Tagen aus den angelieferten Großplatten montiert wurden. 4089 Wohnungen waren Ende 1978 fertiggestellt. Am 31. März 1982 beschloss der Ost-Berliner Magistrat die Rekonstruktion des seit 1977 unter Denkmalschutz stehenden märkischen Angerdorfs Marzahn als ein Denkmal des Städtebaus und der Architektur.
Am 9. Mai 1987 wurde anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins am Kienberg die Berliner Gartenschau (heute: Erholungspark Marzahn, einschließlich der Gärten der Welt) eröffnet.
Im Ergebnis der ersten freien Kommunalwahlen in der DDR vom 6. Mai 1990 trat am 1. Juni 1990 der Sozialdemokrat Andreas Röhl sein Amt als Stadtbezirksbürgermeister an.
Ab dem Jahr 2000 entstand mit dem Bau des Wohngebietes Landsberger Tor auf dem Gelände der ehemaligen LPG zwischen Landsberger Allee und Eisenacher Straße erstmals seit der Wende ein geschlossenes neues Wohnviertel in Marzahn. Letzte Freiflächengestaltungen wurden im darauffolgenden Jahr vollzogen. An der Marzahner Promenade wurde 2005 das fünftgrößte Einkaufszentrum Berlins fertiggestellt, das Eastgate.
Ende 2003 bis Mitte 2005 wurde im Rahmen des Stadtumbaus Ost das Rückbauprojekt Ahrensfelder Terrassen in Marzahn Nord realisiert. Aus elfgeschossigen Plattenbauten wurden Terrassenhäuser unterschiedlicher Höhe mit maximal sechs Geschossen. Damit wurde der Bestand an Wohnungen in den betreffenden Gebäuden von 1670 auf 447 reduziert. Diese neue Attraktion ist inzwischen ein Musterprojekt für verträglichen Stadtumbau geworden und wird gern auch von ausländischen Bauexperten besucht.
Alt-Marzahn ist der historisch erhaltene Dorfanger des bereits im Mittelalter entstandenen Dorfes Marzahn. Gleichzeitig ist es eine darin um den Dorfanger verlaufende Straße. Das gesamte Ensemble mit seinen niedrigen Häusern, der Dorfkirche mit dem Pfarr- und Gemeindehaus, dem historischen Straßenpflaster und einzelnen Gebäuden samt den äußeren Grünflächen steht unter Denkmalschutz. Zu den seit 1977 geschützten Gebäuden gehören außerdem die erste Dorfschule (Hausnummer 51), in der das Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf eingerichtet wurde, und einige – wenn auch etwas umgebaute und vor allem im Inneren modernisierte – Bauernhäuser.
Die evangelische Dorfkirche Marzahn ist eine 1869–1871 nach einem Entwurf von Friedrich August Stüler erbaute neugotische Backsteinkirche. Sie befindet sich auf dem Dorfanger des ehemaligen Angerdorfes und ist in ihrer äußeren Gestalt weitgehend erhalten. Als Einzeldenkmal steht sie wie das umgebende Ensemble des Dorfkernes Alt-Marzahn unter Denkmalschutz. Die alte Dorfkirche, eine in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in frühgotischen Formen erbaute Feldsteinkirche, war seit langen so baufällig geworden, dass sie nur noch abgerissen werden konnte. Bereits um 1782 konnte die Kirche nicht mehr benutzt werden. Gottesdienste fanden in der Schule statt.
Der Erholungspark Marzahn liegt am nördlichen Fuß des Kienbergs und wurde am 9. Mai 1987 anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins als Berliner Gartenschau und Geschenk der Gärtner an die Hauptstadt der DDR eröffnet. Damit sollte er dem Britzer Garten der 1985er BUGA in West-Berlin entgegengesetzt werden.
Im Jahr 1991 wurde die Berliner Gartenschau umgebaut und die Anlage in Erholungspark Marzahn umbenannt: Große Spiel- und Liegewiesen sowie neue Spielplätze entstanden, Bäume wurden gepflanzt und Sondergärten überarbeitet und erweitert. Der neu gestaltete Park sollte den 300.000 Bewohnern der umliegenden Großsiedlungen als vielfältig nutzbare Erholungslandschaft dienen.
Seit der Eröffnung des 1. Themengartens, dem Chinesischen Garten im Oktober 2000 trägt der Park den Titel Gärten der Welt und ist damit auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden.
Im Jahr 2005 wurde der Chinesische Garten in den Gärten der Welt als drittschönste Parkanlage Deutschlands ausgezeichnet. Außerdem gehört der Park zu den 365 Orten im Land der Ideen.
Zu den Gärten der Welt zählen inzwischen:
Chinesischer Garten „Garten des wiedergewonnenen Mondes“.
Japanischer Garten „Garten des zusammenfließenden Wassers“.
Balinesischer Garten „Garten der drei Harmonien“.
Orientalischer Garten „Garten der vier Ströme“.
Koreanischer Garten „Seouler Garten“.
Italienischer Renaissancegarten.
Christlicher Garten. Nachbildung eines mittelalterlichen Klostergartens.
Karl-Foerster-Staudengarten.
Heckenirrgarten & Pflasterlabyrinth.
Seit 2013 wird der Park für die Internationale Gartenausstellung 2017 erweitert und umgebaut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Erholungspark_Marzahn
http://www.gruen-berlin.de/parks-gaerten/gaerten-der-welt/ueberblick/
Die Marzahner Bockwindmühle ist die Rekonstruktion einer bereits im Jahr 1815 im Zentrum des damaligen Dorfes Marzahn in Betrieb genommenen Bockwindmühle. Sie ist in der Abfolge der vierte Mühlenbau und wurde im Jahr 1994 an ihrem heutigen Standort Hinter der Mühle 4 eingeweiht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Marzahn
Biesdorf.
Biesdorf ist ein Ortsteil im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, der 1920 im Rahmen der Bildung von Groß-Berlin Teil des Berliner Stadtgebietes wurde. Zusammen mit Kaulsdorf und Mahlsdorf befindet sich hier Deutschlands größtes zusammenhängendes Gebiet mit Ein- und Zweifamilienhäusern.
Biesdorf selbst wurde (wie viele andere Orte in der Umgebung) 1375 im Landbuch Karls IV erstmals urkundlich erwähnt. Der Dreißigjährige Krieg sorgte in Biesdorf für Zerstörungen und Bevölkerungsschwund: Gab es 1624, also sechs Jahre nach Kriegsbeginn, noch 19 Bauern und 13 Kossäten, so waren es (nach dem Landreiterbericht) 1652 nur noch vier Bauern und sechs Kossäten. 1653 und 1666 erwarb Kurfürst Friedrich Wilhelm Biesdorf in zwei Schritten. Das Dorf wurde dem kurfürstlichen Amt Köpenick unterstellt und verblieb bis 1872 im Besitz des Kurfürsten bzw. Königs. Das Schloss Biesdorf wurde 1868 von Heino Schmieden als spätklassizistische Turmvilla errichtet. Erstmals fand 1874 im Dorf Biesdorf eine Gemeindevertreterwahl statt. Seit der Wende zum 20. Jahrhundert begann in Biesdorf eine verstärkte Siedlungstätigkeit, ab 1904 erhielt der Ort Wasser- und Gasanschluss, erst 1914 kam die Stromversorgung hinzu. Zu dieser Zeit wurde die Villen-Kolonie Biesdorf-Süd angelegt. Bis 1933 entstanden unter anderem die Siedlungen Neu-Biesdorf, Biesdorf-Nord, Kolonie Daheim und Biesenhorst.
Ab 1934 wurden infolge des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ auch in der Anstalt für Epileptische Wuhlgarten Zwangssterilisierungen vorgenommen. Zwischen 1940 und 1942 wurden in Biesdorf die „Gemeinschaftslager“ Nr. 12–14 und 56 des Generalbauinspektors für die Reichshauptstadt als Fremd- und Zwangsarbeiterlager errichtet.
1943/1944 versteckten Gisela Reissenberger und ihre Mutter Elsa Ledetsch in ihren Häusern fünf jüdische Bürger. Sie wurden dafür 1988 von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.
Die Rote Armee erreichte (22./23. April 1945) auch Biesdorf. Teile der Paradiessiedlung (Dillinger Weg, Frankenholzer Weg, Püttlinger Straße)wurden für die Rote Armee beschlagnahmt und durch eine Holzmauer von den verbliebenen Teilen abgetrennt.
Das in Biesdorf befindliche ehemalige Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus (heute das Vivantes Klinikum Hellersdorf Standort Brebacher Weg) wurde 1945 zum Teil von der Roten Armee besetzt. Als die Rote Armee 1970 diese Teile der Klinik freigab, wurde in einigen dieser Gebäude von der SED eine Parteischule für westdeutsche DKP-Mitglieder eingerichtet, die offiziell eine Außenstelle des Franz-Mehring-Instituts der Karl-Marx-Universität Leipzig war. Die Schule war bis 1989 in Betrieb.
Innerhalb der DKP und ihrer nahestehenden Jugendorganisation SDAJ war der Begriff „Biesdorf“ identisch mit „Parteischule“.
Das Schloss Biesdorf wurde 1868 als spätklassizistische Turmvilla auf dem Gelände eines Rittergutes für Hans-Hermann von Rüxleben erbaut.Das Schloss, dem die Architekten Martin Gropius, Heino Schmieden und später Theodor Astfalck sein einst markantes Aussehen verliehen, ging 1927 zusammen mit dem gesamten Gut in den Besitz der Stadt Berlin über und ist seitdem einer stetigen Vernachlässigung ausgesetzt. Ein Brand im Jahre 1945 vernichtete das Obergeschoss, das bislang nicht wieder aufgebaut wurde. Seit 1979 stehen der alte Herrensitz, der Schlosspark und der historische Biesdorfer Ortskern unter Denkmalschutz. 1993 wurde der Biesdorfer Schlosspark, einschließlich Parkbühne, Eiskeller und Teich, nach einer Rekonstruktion wieder eröffnet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Biesdorf
Kaulsdorf.
Kaulsdorf entstand vor 1200 im Zuge der deutschen Ostsiedlung, allerdings nicht als Neugründung („aus wilder Wurzel“), sondern in Umstrukturierung einer slawischen Siedlung, wie der archäologische Befund von vergesellschafteten spätslawischen und frühdeutschen Scherben zeigt. Um 1250 folgte die Errichtung der Dorfkirche Kaulsdorf. Die ersten Wohnhäuser entstanden um die Kirche herum als ein typisches Angerdorf; ungewöhnlich ist allerdings seine Dreiecksform. Infolge des Dreißigjährigen Kriegs wurden 1638 alle Höfe im Dorf verwüstet und waren ohne Bewohner, bis 1652 in Kaulsdorf fast alle Bauern- und Kossätenhöfe wieder besetzt wurden. 1874 fand erstmals in Kaulsdorf, das zum damals neu gebildeten Amtsbezirk Biesdorf gehörte, eine Gemeindevertreterwahl statt. Die Eröffnung des Wasserwerks Kaulsdorf zur Trinkwasserversorgung der Einwohner erfolgte im Jahr 1914. Bis 1920 gehörte der Ort zum Landkreis Niederbarnim, dann wurde Kaulsdorf nach Groß-Berlin eingemeindet.
Die Kaulsdorfer Dorfkirche ist seit mehr als 700 Jahren der Mittelpunkt des Dorfangers. Von den Ursprüngen aus dem 14. Jahrhundert ein Feldsteinbau, ist die Kirche in der Folgezeit wiederholt verändert und verputzt worden. Das ursprüngliche Gotteshaus bestand aus einem gedrungenen Apsissaal romanischen Ursprungs, dessen Entstehung aus der Zeit um 1250 datiert wird, womit die Kirche zu den ältesten Dorfkirchen Berlins gehört. Der barocke Umbau im Jahre 1716 ergab eine Verlängerung des Schiffs bei gleichzeitiger Erweiterung der Fenster.
1875 wurde anstelle des barocken Fachwerkturmes ein aus Backsteinen gemauerter, querstehender, rechteckiger Westbau mit quadratischem Mittelturm in gotischen Formen angefügt. 1945 wurde der Turm durch Kriegseinwirkungen zerstört und durch ein schlichtes Zeltdach als Notlösung ersetzt. Die Wiederherstellung der äußeren Gestalt des Turmhelmes nach historischem Vorbild erfolgte als Ergebnis einer Spendensammlung im Jahre 1999.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Kaulsdorf
Mahlsdorf.
Mahlsdorf wurde um 1230 gegründet. Es war ein Nord-Süd-ausgerichtetes Straßendorf; die Dorfkirche liegt auf der westlichen Straßenseite. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eine nur geringfügige Entwicklung mit rund 250 Einwohnern. Danach kam es – besonders in der Gründerzeit – zu einem explosionsartigen Wachstum, gefördert auch durch eine 1885 eröffnete Eisenbahnstation.
Mahlsdorf gilt als Stadtteil mit sehr günstiger Sozialstruktur und hoher Kaufkraft. Der Sozialindex ist deutlich höher als im Berliner Durchschnitt. Weite Wald- und Wiesenflächen, die Kaulsdorfer Seen, Garten- und Einfamilienhaussiedlungen, Kopfsteinpflasterstraßen und Gaslaternen verleihen Mahlsdorf einen ganz besonderen Charme.
Das ehemalige Gutshaus in Mahlsdorf gehört zu den ältesten Gebäuden in Marzahn-Hellersdorf. Aus einem Lageplan des Jahres 1733 geht hervor, dass das Gebäude nach 1705 erbaut wurde. Das heutige Gutshaus ist um 1815 vollständig neu errichtet worden. Es befindet sich am Südende des ehemaligen Dorfes. Seit 1960 befindet sich im Gutshaus ein Gründerzeitmuseum. Das Museum ist weit über Berlin hinaus ein Begriff und damit die wohl bekannteste Kultureinrichtung des Bezirks. Charlotte von Mahlsdorf (1928 - 2002) http://de.wikipedia.org/wiki/Charlotte_von_Mahlsdorf hatte das private Museum 1960 eröffnet. Heute gehört die Sammlung zu den beeindruckendsten Europas. Sie besteht aus vollständig, vorwiegend im Neorenaissance-Stil eingerichteten Wohnzimmern aus der Zeit zwischen 1870 und 1900.
Die Dorfkirche ist das älteste Gebäude in Mahlsdorf und gehört zu den ältesten Bauwerken Berlins. Das Gotteshaus ist ein frühgotischer Feldsteinbau, erbaut um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Der Grundriss ist typisch für die Zeit um 1250: Das Kirchenschiff ist als gedrungener Langhaussaal ausgeführt, dem sich im Osten ein eingezogener, rechteckiger Altarraum mit geradem Rechteckchor anschließt. Das kurze Schiff besitzt einen bis zum Traufgesims in Schiffsbreite angelegten Westturm, der im Spätmittelalter als schmaler Rechteckturm weitergeführt und am Ende des 19. Jahrhunderts mit einem Längssatteldach abgeschlossen wurde.
Der Gutspark Mahlsdorf ist neben der Parkanlage des Biesdorfer Schlosses die einzig erhaltene historische Parkanlage im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Das Zentrum des Parks ist das Gutshaus, das als Gründerzeitmuseum überregionale Bedeutung besitzt und mit dem Park eine gestalterische Einheit bildet. Der etwa 17 500 qm große Garten ist von einem seiner früheren Besitzer, Hermann Schrobsdorff, bis zu seinem Tode im Jahre 1892 in einen Landschaftspark mit Wegesystem umgestaltet worden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Mahlsdorf
Hellersdorf.
Hellersdorf wurde wie viele andere Dörfer in der Umgebung 1375 im Landbuch Karls IV. erstmals urkundlich erwähnt. Es trug den Namen „Helwichstorpp“ und gehörte den Brüdern Dirike, denen auch ein großes Gut gehört. Zu dieser Zeit besaß Hellersdorf bereits eine Mühle. 1886 erwarb die Stadt Berlin das Gut Hellersdorf und legte östlich der Wuhle Rieselfelder an.Mit der Bildung von Groß-Berlin wurde auch Hellersdorf 1920 eingemeindet und Teil des neuen Bezirks Lichtenberg. Ab 1945 gehörte es zum sowjetischen Sektor Berlins. 1979 wurde Hellersdorf Teil des neu gegründeten Stadtbezirks Marzahn und im Rahmen der Entstehung des Neubaugebietes 1986 Namensgeber des damals neuen Stadtbezirks Hellersdorf. Bis 1990 wurden im Raum Hellersdorf etwa 40 000 Neubauwohnungen errichtet. Das Bild wird vorwiegend von Fünf- und Sechsgeschossern bestimmt.
Als zweitgrößtes Bauprojekt Berlins wurde am 11. September 1997 das neugebaute Stadtzentrum Helle Mitte fertiggestellt und feierlich eröffnet. Rund um den Alice-Salomon-Platz entwickelt sich das Zentrum des Stadtteils Hellersdorf, die "Helle Mitte". Hier konzentrieren sich Einkauf, Dienstleistung, Kultur und Verwaltung. Das Rathaus, ein Multiplex-Kino, das MarktplatzCenter und die Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik prägen den Platz. Im nahe gelegenen Oberstufenzentrum werden junge Menschen in sozialen Berufen ausgebildet. Das neue Gebäude des Arbeitsamtes ist in der Janusz-Korczak-Straße. 1000 neue Wohnungen bieten Lebensqualität. Das Konzept, Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeitgestaltung und Kulturangebote gemeinsam anzubieten, ist aufgegangen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Hellersdorf
hf – 04/2014