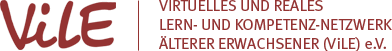Das Gesundheitssystem in Tschechien
Es gibt in Tschechien eine Versicherungspflicht bei freier Kassenwahl. Alle neun Kran-kenkassen erheben staatlich vorgegeben einen Beitragssatz von 13,5 Prozent des Bruttoein-kommens (keine Beitragsbemessungsgrenze). Davon trägt der Arbeitgeber mit neun Prozent zwei Drittel. Für eine zusätzliche Krankengeldversicherung gehen 4,4 Prozent vom Einkom-men ab, von denen drei Viertel der Arbeitgeber trägt. Für Menschen ohne Einkommen über-nimmt der Staat die Beiträge.
Landesdaten
Ausführliche Darstellung:
Nach ihrer friedlichen Trennung von der Slowakei 1992 hat die tschechische Republik ihre Gesundheitssystem radikal umstrukturiert. Die zentralistischen Versorgungsstrukturen aus der Zeit des Sozialismus wurden durch ein beitragsfinanziertes Pflichtversicherungssystem abgelöst. Ein solches System bismarckscher Prägung gab es im heutigen Tschechien schon einmal nach der Staatsgründung der Tschechoslowakei 1918. In seiner jetzigen Form ähnelt das tschechische Gesundheitssystem dem deutschen in weiten Teilen.
Durch die Umstrukturierung haben heute alle Tschechen Zugang zu einer flächendeckenden, umfangreichen medizinischen Versorgung und müssen kaum Zuzahlungen leisten. Aller-dings hat das Gesundheitssystem allmählich mit Problemen zu kämpfen, die eine Diskussion über Reformen in Gang gesetzt haben. Dazu zählen vor allem hohe Krankenhaus- und Arz-neimittelkosten. Und wie in Deutschland existieren nebeneinander Formen der Über-, Unter- und Fehlversorgung. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag 2002 laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei sieben Prozent.
Pflichtversicherung für alle
Alle Einwohner sind
gesetzlich pflichtversichert. Eine private Vollversicherung wie in
Deutschland gibt es nicht. Ebensowenig eine Familienmitversicherung.
Zur Zeit konkurrieren in Tschechien neun Krankenkassen, deren
Beitragssatz der Staat bestimmt. Die Grundleistun-gen der Kassen werden
vom Gesundheitsministerium vorgegeben und sind fast identisch. Der
Leistungskatalog der Kassen umfasst die kostenlose ambulante Versorgung
bei freier Arzt-wahl, kostenlose stationäre Versorgung, Arzneimittel,
Behandlung beim Zahnarzt mit Aus-nahme von Prothesen sowie
Vorsorgeleistungen. Kranken-, Mutterschafts- und Sterbegeld erhalten
tschechische Bürger nicht von der Krankenversicherung.
Zahl der Krankenkassen reduziert
Nach der Reform des
Gesundheitswesens war es den ursprünglich 27 Krankenkassen mög-lich,
auch mit Zusatzleistungen um Versicherte zu werben. Als Folge entstand
ein Wettbe-werb um teure Extras, die neben sprunghaft steigenden
Grundleistungen die Kosten zusätzlich in die Höhe trieben. Viele Kassen
gerieten in finanzielle Not und verschwanden durch Fusio-nen oder
Pleiten vom Markt. Zudem wurde laut WHO eine Mindestgröße für
Krankenkassen eingeführt: Sie müssen mindestens 50.000 Bürger
versichern. Dadurch ging die Zahl der Krankenversicherungen zwischen
1995 und 2000 auf neun zurück. Acht von ihnen entspre-chen deutschen
Betriebskrankenkassen – darunter Versicherungen des Autoherstellers
Skoda oder des Innenministeriums.
Wie in der Bundesrepublik sind jedoch die meisten Bürger, nämlich zwei Drittel, bei einer staatlichen Krankenkasse versichert, die der deutschen AOK entspricht. Tschechische Kran-kenkassen müssen jeden Bürger versichern. Manche Ärzte versuchen allerdings, „teure“ Pati-enten zum Wechsel in eine betriebliche Kasse zu überreden, da diese zum Beispiel keine Budgets für Arzneimittel haben. Kontrolliert werden die Kassen durch paritätisch besetzte Verwaltungs- und Aufsichtsräte. Sie bestehen zu je einem Drittel aus staatlichen Vertretern, Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
Arbeitgeber tragen Hauptanteil des Beitragssatzes
Der einheitliche Beitragssatz der Krankenkassen lag 2002 laut WHO bei
13,5 Prozent des Bruttogehalts. Der Arbeitgeber trägt bei Beschäftigten
neun Prozent, 4,5 Prozent tragen die Arbeitnehmer. Eine
Beitragsbemessungsgrenze gibt es nicht. Etwa die Hälfte der
Bevölke-rung hat kein eigenes Einkommen (Arbeitslose,
Sozialhilfeempfänger, Studierende, Frauen im Mutterschaftsurlaub usw.).
Für sie bezahlt der Staat einen festen Beitrag von etwa 13 Euro im
Monat, für Rentner rund 40 Euro. Selbständige leisten einen Beitrag bis
zur Bemessungsgren-ze von maximal 35 Prozent ihres Gewinns. Wer keinen
Gewinn erzielt, zahlt eine Mindestbei-trag von knapp 30 Euro pro Monat.
Zuzahlungen müssen Versicherte für einige Medikamente sowie Kuren,
Heil- und Hilfsmittel aufbringen.
Risikostrukturausgleich
Auch Tschechiens Gesundheitswesen
kennt einen Risikostrukturausgleich. Gespeist wird er durch die
Beiträge, die der Staat für Rentner, Arbeitslose etc. bezahlt, sowie
durch 60 Prozent der Einnahmen aller Kassen. Aus diesem Solidartopf
erhält jede Krankenkasse einen Anteil entsprechend der Zahl ihrer
staatlich Versicherten.
Staatsanteil an der Versorgung
Vor dem Ende des Warschauer Paktes dominierten auch im heutigen
Tschechien Polikliniken und Gesundheitszentren die Versorgung. Im
stationären Bereich ging die Privatisierung nur zögerlich voran; die
meisten Einrichtungen sind noch immer in öffentlicher Hand. Die
ambu-lante Versorgung wurde dagegen komplett neu organisiert. Nahezu
alle Ärzte arbeiten privat auf eigene Rechnung. Allgemeinmediziner,
Kinderärzte, Gynäkologen und Zahnärzte sichern dabei die
Grundversorgung. Versicherte können aus diesen Gruppen einen Hausarzt
frei wäh-len, an den sie dann drei Monate gebunden sind.
Facharztbesuche ohne Überweisung sind erlaubt.
Oft Doppeluntersuchungen
Hausärzte haben kaum Möglichkeiten, die ambulante Versorgung zu
steuern. Sie bekommen in der Regel keine Informationen, welche
Therapien andere Ärzte ihrem Patient verordnen oder welche anderen
Mediziner der Patient aufsucht. Die Folge: Doppeluntersuchungen oder
Probleme bei der Arzneimittelverordnung. Meistens arbeiten Hausärzte in
Einzelpraxen mit eigenen medizinischen Geräten, die oft auch ohne
wirklichen Bedarf eingesetzt werden. Nur wenige Mediziner mieten sich
in ehemalige Polikliniken ein, in denen auch Fachärzte arbeiten, um so
vorhandene Geräte mitzunutzen. Krankenhausambulanzen ergänzen die
Versorgung im nicht-stationären Bereich. Sie rechnen ihre Kosten direkt
mit den Krankenkassen ab.
Kopfpauschalen
In den ersten Jahren des neuen Systems
erhielten Hausärzte leistungsbezogene Honorare. Dies hatte den Effekt,
dass viele Ärzte durch möglichst viele Leistungen ihr Einkommen erhöhen
wollten. Mittlerweile erfolgt die Vergütung über Kopfpauschalen. Dabei
werden Patienten unterschiedlichen Risikogruppen zugeordnet. Fachärzte
werden nach einem Punktesystem bezahlt, das eine Ausgabengrenze je
Versicherten beinhaltet. Technisch gut ausgestattete und deshalb
teurere Praxen erhalten dabei mehr Geld.
Die Krankenkassen schließen mit Leistungserbringern Einzelverträge ab. So können sie gezielt Anreize schaffen, um Schwachpunkte in der Versorgung abzubauen. Dieser Nutzen wiegt den größeren Verwaltungsaufwand auf.
Hohe Arztdichte
Nach Litauen hat Tschechien die höchste
Arztdichte der neuen EU-Mitgliedsstaaten: Im Jahr 2002 versorgten
durchschnittlich 350 Ärzte 100.000 Einwohner. In Deutschland waren es
336 Ärzte je 100.000 Einwohner (2001).
Krankenhäuser
Jede zweite Krone in der tschechischen
Krankenversicherung fließt in den Krankenhausbe-reich. Die Zahl der
Betten wurde zwar gesenkt und lag 2002 bei 860 je 100.000 Einwohner.
Das entspricht nach Litauen noch immer der zweithöchsten Bettendichte
unter den Beitritts-ländern und reicht fast an deutsche Verhältnisse
heran (2001: 901 Betten je 100.000 Einwoh-ner). Wirkungsvolle
Einsparungen versprechen sich auch die Tschechen durch die Einfüh-rung
von Fallpauschalen.
Tschechische Kliniken gehören noch immer dem Staat
Großkliniken mit mehr als 1.000 Betten halten alle Fachrichtungen vor
und dienen zugleich als Lehrkrankenhäuser. In Distrikt-Krankenhäusern
mit 700 bis 1.000 Betten sind die wich-tigsten Fachrichtungen
vertreten. Die stationäre Grundversorgung vor Ort sichern lokale
Kli-niken mit bis zu 200 Betten. Sie verfügen meistens über die
Abteilungen Chirurgie, Inneres, sowie Kinder- und
Frauenheilkundeheilkunde.
Versorgung mit Arzneimitteln
In Tschechien gibt es etwa
2.200 Apotheken. Die meisten befinden sich in privatem Besitz. Daneben
sichern in kleinen und entlegenen Ortschaften rund 230
Arzneimittel-Ausgabestellen die Versorgung mit Medikamenten. Die
Ausgaben für Arzneimittel sind im Laufe der Jahre kontinuierlich
gestiegen. Sie lagen 2003 nach Angaben des internationalen
Marktforschungs-unternehmens IMS Health bei 28 Prozent der Gesamtkosten
(Deutschland 2003: 16,7 Pro-zent).
Positivliste für Medikamente
Um die Ausgaben zu senken, wurde eine Positivliste eingeführt. Sie
verzeichnet 500 erstat-tungsfähige Präparate. Voll erstattet werden nur
die billigsten Mittel einer Wirkstoffgruppe, vorwiegend Generika aus
landeseigener Produktion. Alle anderen Arzneimittel sind
zuzah-lungspflichtig. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Arzt nachweist,
dass es zum jeweiligen Produkt keine Alternative gibt. Die Positivliste
legt außerdem Indikationen für die Arzneimit-tel fest und bestimmt,
welche Produkte nur von Spezialisten verschrieben werden dürfen.
(Autorin: Friedel, Quelle AOK )