
Ausgabe Nr. 35 Online-Journal zur allgemeinen Weiterbildung älterer Erwachsener
Tief in uns
Das ist doch ein gutes Omen: Ich finde ein Hufeisen. Nur muss ich
beim Aufhängen aufpassen, dass die Öffnung stets nach oben zeigt, sonst
fällt das Glück heraus. Oh weh, aber was bedeutet das? Eine schwarze
Katze läuft mir über den Weg. Droht Unheil? Vielleicht sollte ich jetzt
schnell ein paar Stoß- und Bußgebete zum Himmel schicken.
Sicher kennt ein jeder – oft uneingestanden – solche Gedanken und
Befürchtungen.
Gemeinhin heutzutage als Aberglauben abgetan, wurzeln diese
Vorstellungen tief in uns. Was viele nicht ahnen: Dieses Erbe, die
Wahrsagerei über die Zukunft war als ein Teil der angewandten,
alltäglichen Magie im Mittelalter in allen Schichten, bei Gelehrten,
Kirchenmänner und dem gemeinen Volk, weit verbreitet. Die Magie
Deutungen und Handlungen zur Bewältigung der Umwelt.![]()
Geheime Kräfte
Laut Duden versteht man unter Magie die „Zauberkunst, Geheimkunst,
die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht“. (Das ist nicht
zu verwechseln mit der Trickkunst des Zauberers in einem Varieté.) Die
Magie mit ihren verschiedenen Praktiken wurzelt In vielen Kulturen.
„Persische, babylonische und ägyptische Überlieferungen bildeten die
Grundlage der ‚wissenschaftlichen’ Systeme von geordneten Vorschriften,
Regeln und Bräuchen“, informiert Christa Tuszay im österreichischen
Focus. Magie war die Wissenschaft seit altersher. Besonders die jüdische
Kultur habe eine okkulte Tradition gepflegt. Aus der Systematisierung
ihrer Geheimlehre sei die Kabbalah, eine mit Buchstaben- und
Zahlendeutung arbeitende Geheimlehre, hervorgegangen.![]()
Zusammenspiel

(Quelle: Wikipedia)
Systematische Anweisungen, wie sie die Zauberpapyri enthielten, hätten
es den Adepten ermöglicht, mit den höheren Mächten umzugehen und diese
zu eigenen Zwecken zu ge- bzw. missbrauchen, so Tuszay. Die Magie
beherrschte den Alltag, bot Handlungsanweisungen, Bewältigung und Schutz
im Alltag. Aber auch zur Erklärung des Kosmos. Agrippa von Nettesheim
(1486 in Köln – 1535 in Grenoble) versuchte eine Systematisierung der
Magie. Er klassifizierte elementarische, himmlische und geistige Kräfte
der Magie. Die Magie umfasst alles Wissen der Weisen. Die verborgenen
Kräfte durchströmten alles –so hänge alles mit allem zusammen. Professor
Karl-Heinz Göttert, Universität zu Köln: „Es war möglich, mit der
göttlichen Welt Kontakt aufzunehmen.“ Die Magie war Wissenschaft und
Kunst.![]()
Magie war Alltag
Im Spätmittelalter und früher Neuzeit wurde Magie zum
Grundbestandteil des Alltags. Wie Michael Kasper aus der Vorlesung WS
2003/04 des Innsbrucker Universitätsprofessor Alois Niederstätter
auflistet, spielte Magie in zahlreichen Lebensbereichen eine Rolle. Da
Krankheiten naturwissenschaftlich nicht erklärbar waren, wurden sie oft
auf das Wirken von bösen Mächten (Dämonen, Hexen…) zurückgeführt. Auch
magische Praktiken gab es, um Liebe zu erzwingen oder herbeizuführen. Es
gab Magie mit Lebensmitteln, Worten und Gegenständen. Eine solchermaßen
dämonische Magie beruhte auf einen Pakt mit dem Teufel. Das galt
besonders für den Schadenszauber. Den berühmtesten Teufelspakt aus
Wissensdurst, Armut und Erfolglosigkeit zeigt Goethes Faust (Tuczay).
![]()
Gottesstaat Kirche
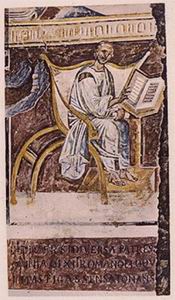
(Quelle: Wikipedia)
„. . Jesus erregte durch seine Exorzismen und
Wunder den Verdacht der talmudischen Lehrer, die ihn als Magier
brandmarkten. Auch die Apostel kamen in Zaubereiverdacht . . .“, führt
Tuczay aus. Der Beziehung von christlicher Kirche und Magie gibt
Kirchenlehrer Augustinus (354 – 430) einen Rahmen. Professor Göttert,
Köln: Der Kirchenlehrer Augustinus (353– 430) habe in seinen Schriften
versucht, dem Gottesstaat (Kirche) gegenüber dem weltlichen Reich
(Römisches Reich) eine eigene Position einzuräumen. Beide Reiche sollten
nebeneinander bestehen. Augustinus habe mit seinen 22 Bänden versucht,
das Christentum zu retten. „Augustinus („De Civitate Dei“) hat den
Grundlage für den Dämonenbegriff des Mittelalters geschaffen.“![]()
Kontakt verboten
Augustinus sieht die Welt der heidnischen Götter als gegeben an. Er
setzt sie mit Dämonen gleich. Göttert: „Augustinus bekämpft den Kontakt
mit ihnen.“ Denn Dämonen seien entscheidend gekennzeichnet durch
Verzweiflung, da sie nicht erlöst werden könnten. Aus diesem Grunde
seien sie neidisch auf die Menschen, die noch Hoffnung auf Erlösung
hätten. Laut Augustinus würden sich die Dämonen durch Wahrsagung,
Traumdeutung, Wunderwirkung u.ä. den Menschen anbiedern. Göttert: „Durch
Mittlerdienste wollen die Dämonen die Menschen auf schlechte Pfade
lenken, so dass sie nicht mehr erlöst werden.“ Augustinus erkenne neben
den Dämonen auch die Engel, die böse und gut sein können, während die
Dämonen, die im irdischen Reich herrschten, böse sind. Dabei sei alles
Eingehen auf abergläubige Praktiken eine Anbandelung mit Dämonen, sprich
Teufel.
![]()
Rolle des Neides

(Quelle: Wikipedia)
Da alle Vorkommnisse durch bestimmte Mächte verursacht würden, so der
Innsbrucker Professor Niederstätter in einer Vorlesung, wurden also auch
Glück und Unglück Ahnen, Geistern oder eben Hexen zugeschrieben. Das bot
Gelegenheit, persönliche Feinde als Hexen zum Feind der ganzen
Gesellschaft zu machen. Wirtschaftlicher Neid sei ausschlaggebend für
die ersten Hexenprozesse gewesen. Folglich: „Die ersten Hexenprozesse
wurden gegen Männer geführt, so dass wirtschaftliche Konkurrenten
ausgeschaltet werden konnten“, berichtet Göttert von dem Gebiet um
Unterwallis im frühen 15. Jahrhundert. Fortschrittliche Bauern hätten
damals von der reinen Selbstversorung auf Im- und Export umgestellt. Ein
Prozess, der für andere mit sozialen Rückschritten verbunden gewesen
sei.![]()
Hexen existieren
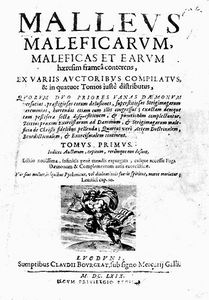
(Quelle: Wikipedia)
Der Hexenhammer (Malleus Maleficarum, Erstdruck
1487) von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris lieferte rechtliche
Grundlagen bei Schadenzauber, also für die Hexenprozesse. Dabei
verfolgte der Autor Inisistorius insbesondere die Frauen. Besonders
frauenfeindliche Ausführungen finden sich in dem Kapitel über Hexen, die
sich den Dämonen sexuell unterwerfen. Für Institoris war die
Schlechtigkeit der Frau die Voraussetzung für Hexerei. Auch müssten
Hexen wie Ketzer bestraft werden. Zur Erinnerung: Damals glaubten alle,
auch die Kirche und die Gelehrten, an die Existenz der Hexen, nicht
jedoch an deren Taten. Das gilt selbst für Friedrich von Spee, dessen „Cautio
Criminalis“ gegen das Unwesen der Hexenprozesse1631 erstmals anonym
erschienen ist.![]()
Mehr als Aberglaube
Magie war mehr als Aberglaube. Mit ihr sollte die Welt, die
Weltordnung erklärbar verständlich gemacht werden. Die Anwendung
magischer Praktiken und der Glaube an deren Wirksamkeit sei, laut
Profesor Niederstätter, in der gesamten Bevölkerung des späten
Mittelalters verbreitet gewesen. Die Dämonisierung der Magie
(Schadenzauber) sei verfolgt worden und diente der sozialen Kontrolle
und Sanktionierung. Seit Ende des 18. Jahrhunderts sei die „Magie in den
Untergrund geraten“, so Göttert. Die Magie habe Analogien geboten, nie
Kausalitäten. Mit Renaissance und beginnender Aufklärung sei sie von der
Naturwissenschaft zunehmend verdrängt worden, so auch Tuczay. Grundlagen
für die heutige Welt hätten Mechanik und Chemie geschaffen.![]()
Der Teufel lebt

(Dieses Bild basiert auf dem Bild
Aachen_devil_and_woman.jpg aus
der freien Enzyklopädie Wikipedia
und steht unter der
GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist
Ahoerstemeier.)
Und heute, die Welt ohne Magie, ohne Teufel? Nein,
denn Teufel gibt es noch in unserer aufgeklärten Welt. In der
Katholischen Kirche gibt es noch immer Priester, die als Exorzisten
tätig sind. „Der Teufel lebt“, titelte in 1989 Monsignore Corrado
Balducci, Spezialist im Vatikan für alle Fragen, Satan betreffend, sein
Werk. Laut Süddeutscher Zeitung zähle man 1 758 640 176 Teufel.
Demgegenüber gebe es 99mal so viele Engel wie Menschen, die je auf der
Erde gelebt haben oder leben werden.
![]()
Links
http://www.focus.at/artikel/ct_magie.html
www.uni-koeln.de (Philosophische
Fakultät, Prof. Göttert)
http://www.textlog.de/1777.html?print Archiv der Süddeutschen
Zeitung
![]()